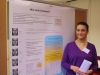Lange Nach der Wissenschaften: Ich verbrachte die in der Rostlaube an der Habelschwerdter Allee. Fotos: Grützner
Ich bin ein glücklicher Mensch. Das weiß ich seit Samstagabend. Gesagt hat mir das ein wissenschaftlicher Glückstest.
Es ist Lange Nacht der Wissenschaften an der FU und ich bin mittendrin. Der Zufall führt mich zunächst ins John F. Kennedy-Institut. Mark Twain höchstpersönlich liest aus seinem „Tom Saywer“ vor. Ich muss feststellen, dass mein Englisch nicht so gut ist, wie ich dachte. Ob das wohl daran liegt, dass ich mich selbst durch eine rosarote Brille betrachte und besser von mir denke, als ich es möglicherweise bin? Das höre ich zumindest in der Rost- und Silberlaube beim “FUture Slam”. Zehn Minuten haben die Wissenschaftler Zeit, ihre Forschungen vorzustellen. Mit flinker Zunge und Stoppuhr im Rücken sausen sie durch das Weltall, Gender und mein Gehirn. Und so weiß ich jetzt, dass sogenannte „Pfade“ für eine Automatisierung bestimmter Verhaltensweisen sorgen und dass wir Menschen positive Äußerungen über uns gut annehmen können, negative aber eher ignorieren. So kann Wissenschaft echt Spaß machen. Das finden wohl die anderen Zuhörer auch, es gibt ordentlich Applaus und ich überlege, ob ich doch noch einmal studieren sollte.
Nach der Theorie wird es nun Zeit für ein wenig mehr Selbsterkenntnis. Auf geht es zu den Psychologen. Die Gesundheitspsychologen haben einen Glückstest erstellt. Den will ich machen – so wie zahlreiche andere Besucher, die in einer Schlange vor dem Raum anstehen. Manche sind gut ausgestattet, haben ein Buch dabei, um sich die Wartezeit zu verkürzen. Von der Resonanz sind auch die Diplom-Psychologinnen Milena Koring und Daniela Lange erstaunt und erfreut. Die beiden jungen Wissenschaftlerinnen haben den Test erstellt. Eine spontane Idee, wie sie erzählen. „Glück ist derzeit in aller Munde“, nicht nur beim Kabarettisten Dr. Eckhart von Hirschhausen, sondern auch in der aktuellen Forschung, berichten Lange und Koring.
Und so arbeite ich mich 20 Minuten lang durch zahlreiche Fragen zu meiner Familie, meinen Freunden, meiner Ernährung und meinen sportlichen Aktivitäten– bei den beiden letzten Kategorien bekomme ich ein schlechtes Gewissen, denn darum ist es bei mir nicht gut bestellt. Trotzdem reicht es für einen Glücksquotienten von 111. Der wurde dem Intelligenzquotienten nachempfunden und liegt im Durchschnitt bei 100. Trotz des guten Ergebnisses entscheiden ich mich beim Verlassen des Testraumes für Obst statt für Schokolade – das schlechte Gewissen der Ernährung wegen. Sport und Ernährung sind übrigens auch die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um glücklicher zu werden, erklären mir die beiden Psychologinnen. Am Alter und Geschlecht, die ebenfalls eine wichtige Rolle beim Glücklichsein spielen, ist das ja nicht so einfach möglich oder zumindest sehr teuer. Den Test kann man übrigens auch zu Hause machen, ab 12. Juni findet man ihn hier.
Gut doppelt so lange wie der Glücks- dauert ein Test, der meine Empathiefähigkeit messen soll. Entwickelt wurde der von Dr. Isabel Dziobek, Gruppenleiterin „Understanding Interaffectivity“ an der FU. In einem Film werden Interaktionen gezeigt, erklärt mir Renata Wacker vom Fachbereich. Dazu gibt es einen Fragebogen, auf dem ich das Gesehene einordnen und bewerten muss. Der Test zeigt dann, ob ich andere Menschen verstehe, ob ich mich in sie einfühlen kann. Das klingt spannend, doch auch hier ist der Andrang groß und mit fehlt die Muße, so lange zu warten. Und so schaue ich mir nur die Plakatwände an, die mir erklären, was Empathie ist und wie die sieben kulturell unabhängigen emotionalen Gesichtsausdrücke aussehen. Die kenne ich allerdings schon – als treuer Zuschauer der Serie „Lie to me“, die auf den Erfahrungen des Psychologen und Anthropologen Paul Ekman basieren.
So viel Wissenschaft macht hungrig und durstig. Tee bekomme ich kostenlos beim Institut für Geografie, Tofubällchen beim Mensateam des Studentenwerkes. Ein kulinarischer Abschluss eines wissenschaftlichen Abends.
(go)